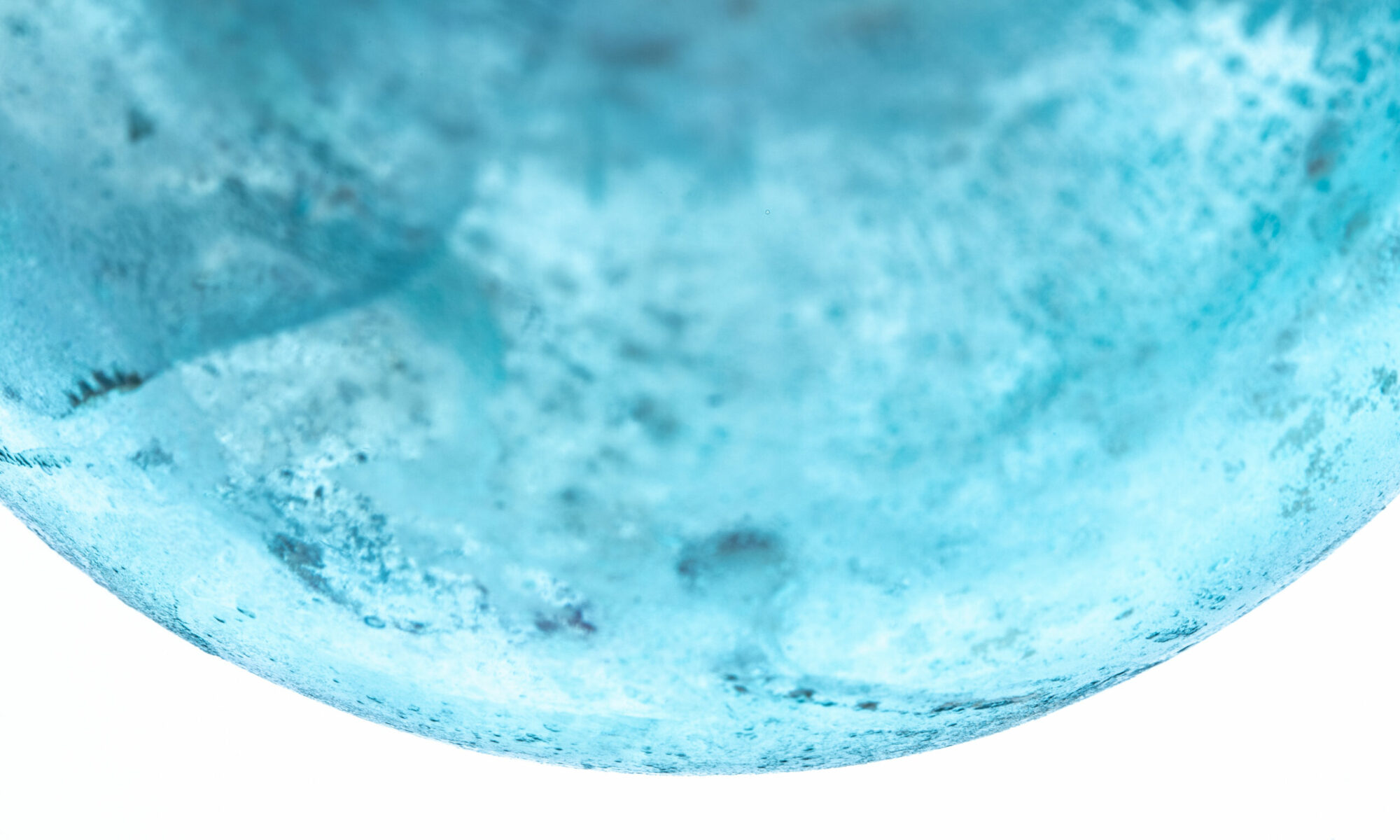ARCHÄOLOGISCHE GRUNDBEGRIFFE
16.–17.10.2025
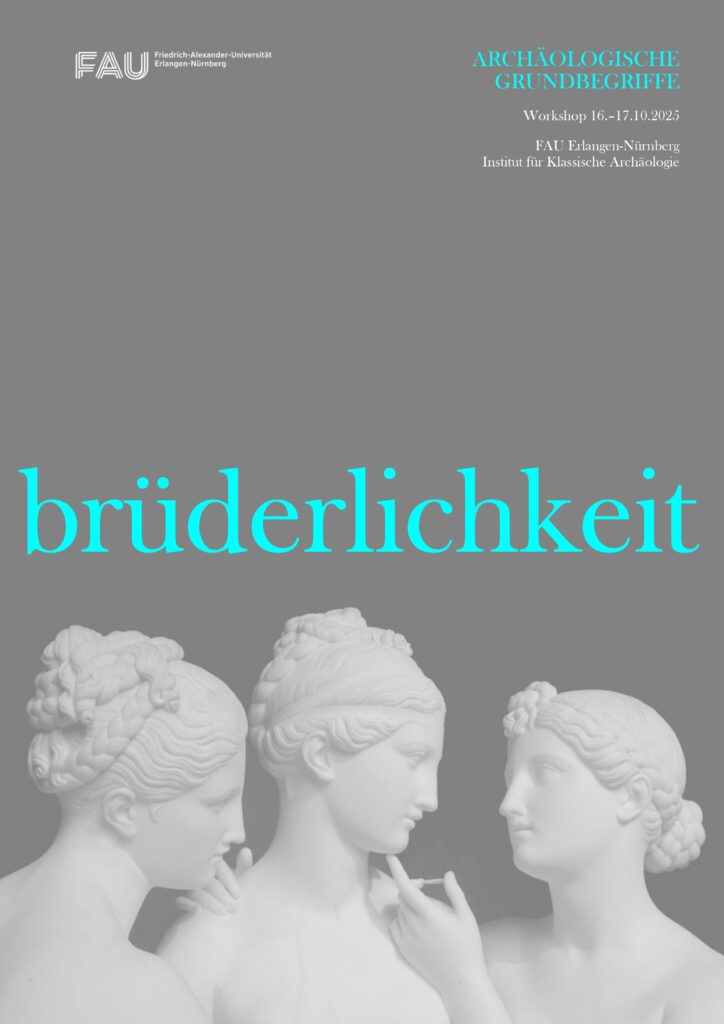
Der nächste Workshop der Reihe ‚Archäologische Grundbegriffe‘ widmet sich dem Konzept der Brüderlichkeit. Analog zu den erfolgreichen Workshops ‚Freiheit‘ und ‚Gleichheit‘ steht damit erneut eine Idee der Aufklärung im Zentrum, die als Schlüssel zur Frage nach der ethischen Dimension antiker Bilder, Objekte und Befunde dienen wird.
Thema ist das immense Spektrum der archäologischen Befunde und bildlichen Repräsentationen solidarischen Verhaltens. Dabei ist Brüderlichkeit ein Begriff, der in krassem Gegensatz zu interessengeleiteten Beziehungen wie ‚amicitia‘ oder ‚do ut des‘ steht: Von der Phratrie bis hin zur ptolemäischen Geschwisterehe konnten antike Gruppenbildungen ihren Zusammenhalt ganz ausdrücklich mit dem genuin genetischen Aspekt des Bruder- oder Schwesterseins aufwerten.
Das Bild der Brüderlichkeit – verstanden in strikt geschlechtsneutralem Sinn – bezieht sich auf viele Formen unhinterfragter, uneigennütziger und frei gewählter Unterstützungsbeziehungen. Allerdings rückt der Begriff den Fokus auf die Dynamik verwandtschaftlicher Verpflichtungen: Mit Blick auf die Antike konnte die Dialektik familiärer Beziehungen etwa am Beispiel mythologischer Geschwister wie Elektra und Orest, Kleobis und Biton, Romulus und Remus, Medea und Apsyrtos, der Gorgonen, Grazien oder Niobiden zum Ausdruck kommen – teils in vorbildhafter, teils in katastrophaler Weise.
Im weiteren Sinne trägt der Begriff der Brüderlichkeit aber auch die Möglichkeit der Überschreitung, oft Überwindung der zufälligen Verwandtschaftsbeziehung in sich. So zeichnen sich Urkunden-, Weih-, Grab- oder historische Reliefs durch ästhetisch subtil abgestufte, oft intime Interaktionen zwischen dargestellten Individuen aus. Das methodisch konservative Verständnis solcher Interaktionen als bildlicher Ausdruck sozialer Akteursnetzwerke eröffnet dabei einen nur sehr oberflächlichen Interpretationsbereich – während die heuristische Anwendung des Begriffs der Brüderlichkeit mit seinem historisch weitgefächerten semantischen Feld die Chance bietet, normative und ethische Tiefenschichten freizulegen.
Einen dritten produktiven Untersuchungsbereich bildet die religiöse Sphäre der Personifikationen. Hier materialisieren sich auch für die folgenden Jahrtausende relevante Begriffe: ‚homonoia‘ und ‚concordia‘, ‚eusebeia‘ und ‚pietas‘, ‚eirene‘ und ‚pax‘. Lassen sich solche und ähnliche Verkörperlichungen ohne die im Begriff der Brüderlichkeit mitgedachte Dimension der Verwandtschaftsbeziehung überhaupt erklären? Entzog, so wäre im Anschluss zu fragen, das neunzehnte Jahrhundert der Idee vom zwischenmenschlichen Universalkonsens ihre seit der Antike virulente, anthropologische Schärfe, indem es den Begriff der ‚fraternité‘ durch den Surrogatbegriff der ‚Solidarität‘ ersetzte? Und was trägt die bild- und befundbasierte Begriffsgeschichte der Brüderlichkeit zur Klärung solcher und vieler anderer Fragen bei?
Programm (Stand 25.9.2025, kurzfristige Änderungen möglich)
Donnerstag, 16.10.2025
Senatssaal im Kollegienhaus, Universitätsstraße 15, 91054 Erlangen | google maps
13–20 Uhr Sektion 1
Andreas Grüner (Klassische Archäologie, Erlangen) Einführung
Corinna Reinhardt (Klassische Archäologie, Zürich) Ritualgebundene Schwesternschaft? Überlegungen zur Votivpraxis im Demeter- und Korekult
Karl Hepfer (Philosophie, Erfurt) Brüderlichkeit – Handeln nach Gefühl?
Elisabeth Günther (Klassische Archäologie, Heidelberg) Concordia auf römischen Münzen
Karen Oostenbrink (Germanistik, München) Ce n’est pas moi, c’est toi: Fotografie und Schwesterlichkeit in Annie Ernaux‘ L’autre fille
Stefan Schaffner (Indogermanistik, Erlangen) Zur Etymologie von ‚Bruder‘ und ‚Schwester‘ im Lateinischen und Griechischen
Thorsten Uthmeier (Ur- und Frühgeschichte, Erlangen) Die Inszenierung enger sozialer Beziehungen in Bestattungen der späten Altsteinzeit (34.000 – 25.000 Jahre vor heute)
Martina Kastnerová (Anglistik, Pilsen) “One of excellent good proof, the second of great good hope”: political frustration in the neoplatonic poetry of the younger brother Robert Sidney (1563-1626), fraternity, mentoring, imitation, and two poetic concepts of the Sidneyan brothers
Johannes Eber (Klassische Archäologie, Zürich) Brüder im Geiste
Freitag, 17.10.2025
Senatssaal im Kollegienhaus, Universitätsstraße 15, 91054 Erlangen | Google maps
9–13 Uhr Sektion 2
Joachim Knape (Allgemeine Rhetorik, Tübingen) Bürderlichkeit der Bildzeichen. Semantische Solidaritäten und Unmöglichkeiten im Bild
Elisa Bernard (Klassische Archäologie, Erlangen) Fraternal Sculptures
Alexander Heinemann (Klassische Archäologie, Tübingen) Brüder im Geiste. Griechische Zecherpaare beim Einüben einer sozialen Grundfertigkeit
Simon Kienzl (Germanistik, München) Neapel schreiben: Zwischen horizontalen und vertikalen Familienformationen
Martin Kovacs (Klassische Archäologie, Tübingen) Rangfolge unter Brüdern. Die Söhne Konstantins des Großen und ein augusteisches Münzbild
14.30–19 Uhr Sektion 3
Thomas Reiser (Italienische Philologie, München) Fraternity betwixt Hermaphrodite Twins. An Entanglement of Myths, Loyalties and beffe in Bernardo Dovizi da Bibbiena’s Calandria, Commedia elegantissima (1513/15)
Sven Günther (Alte Geschichte, Changchun) Brüder auf Münzen der Römischen Republik
Nathalie-Josephine von Möllendorff (Kunstgeschichte, Bamberg) Die Architektur sozialer Gerechtigkeit: Der Großgalgen von Montfaucon und die Pariser Kathedrale Notre-Dame als kontradiktorische Motive der Brüderlichkeit bei Victor Hugo
Franziska Stolz (Anglistik und Amerikanistik, München) „My dear Sister“: Poetologie und Politik der Familie in Mary Shelleys Frankenstein
Julian Schreyer (Klassische Archäologie, Erlangen) Massengotthaltung
■
Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben. Eine Anmeldung zu dem Workshop über arch-grundbegriffe@fau.de wird empfohlen.
Organisation: Prof. Dr. Andreas Grüner, Dr. Julian Schreyer
Eine Veranstaltung der Reihe Archäologische Grundbegriffe.